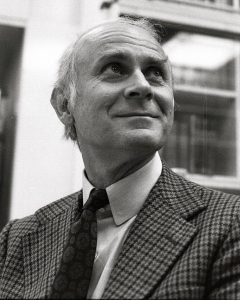Peter Cornelius zum 200. Geburtstag und zum 150. Todestag
Er würde wohl zu den vielen vergessenen Komponisten zählen, wäre da nicht sein Opus 8: sechs Weihnachtslieder, komponiert im Advent 1856, von denen zwei, „Die Hirten“ und „Die Könige“, es noch regelmäßig auf die Programmzettel von Konzerten schaffen. Und irgendwie ist das passend: Peter Cornelius wurde am 24. Dezember 1824, abends um zehn, in Mainz geboren.
Seinerzeit verkehrte der Sohn eines bekannten Schauspielers mit allen, die Rang und Namen hatte: Liszt und Wagner zählte er zu seinen Freunden, Bettina von Arnim bot ihm einen Job als eine Art Sekretär an, Mendelssohn, Meyerbeer und Berlioz schrieben ihm Empfehlungen. Und noch 1905/06, mehr als dreißig Jahre nach seinem Tode, erschien eine fünfbändige Ausgabe seiner Musik, ein Jahr, nachdem seine gesammelten Schriften (vor allem Briefe) ebenfalls im Verlag Breitkopf erschienen waren.

In seiner autobiographischen Skizze, gedruckt im Jahr seines Todes, kommt er leider nur bis zu seinem Opus 1. „Mein Leben dreht sich um zwei Pole: Wort und Ton. Im Anfang war das Wort“, schreibt er dort. Und auch wenn er nach dem frühen Tod seines Vaters 1843 seine Schauspielerambitionen aufgab und sich ganz der Musik zuwandte, blieb er dem Wort doch eng verbunden: Ungefähr zur Hälfte seiner vielen Lieder und zu seinen drei Opern hat er die Texte selbst verfasst. In seinem fast ausschließlich vokalen Schaffen dominieren Liedersammlungen (für Männer- und gemischten Chor, Duette und Solo-Lieder), doch bemerkenswert ist beispielsweise auch das Requiem auf einen Text von Hebbel.
Sein großes Talent als Musiker erkennt man leicht: In einem Brief an seinen Bruder berichtet Cornelius 1839, seit genau einem Jahr Geige zu lernen. Und schon im folgenden Jahr taucht er als Mitspieler im Orchester auf – mit dem er bald auf England-Tournee geht. Im März 1841 berichtet er von dort stolz, im „Freischütz“ habe er „kein einziges Mal die kleinste Störung verursacht“. Er übt damals zwei Stunden Geige und zwei Stunden Klavier pro Tag. 1844 geht er nach Berlin, wo ihm Mendelssohn rät, Unterricht beim bekannten Siegfried Dehn zu nehmen. Cornelius zahlt dreieinhalb Taler im Monat für seine Unterkunft bei einem Schneider und acht Taler, also mehr als doppelt so viel, für den Unterricht. Doch seine Versuche, beruflich auf die Füße zu kommen, scheitern. Er wohnt mit Blick auf den Potsdamer Bahnhof, schaut sehnsüchtig auf die Züge, die in die weite Welt fahren, und lebt vom Unterrichten.
1852 zieht er nach Weimar. Franz Liszt rät ihm, nachdem er seine Kompositionen studiert hat, sich auf die Kirchenmusik zu konzentrieren. Und sogleich setzt sich Cornelius an eine Messe. Obwohl Protestant, interessiert er sich sehr für die katholische Musikwelt. 1853 wird Peter Cornelius Liszts Privatsekretär und wohnt auch zunächst bei ihm. Doch das hat nicht nur Vorteile: „In Liszts Nähe verlor ich den Mut zu eigenem Schaffen gänzlich“, notiert er in seinem Tagebuch. Bei längeren Aufenthalten bei seiner Familie im thüringischen Bernhardshütte bei Sonneberg findet er übers Liederschreiben zum Komponieren zurück.
1859 endet seine Weimarer Zeit, als Liszt-Gegner die Uraufführung des „Barbiers von Bagdad“, Cornelius’ erster Oper, stören. Er geht nach Wien, wo er seine zweite Oper, „Der Cid“, komponiert und wo seine Zusammenarbeit mit Richard Wagner beginnt. Der holt ihn 1864 nach München. Hier bekommt Cornelius 1867 endlich eine feste Stelle an der Musikhochschule und heiratet im selben Jahr – vorher waren seine Heiratswünsche stets an seinem Status eines armen Musikanten gescheitert, wie er seinem Tagebuch anvertraut. Seine letzte Oper kann er nicht mehr vollenden. Am 26. Oktober 1874, vor 150 Jahren, stirbt er während einer Reise in seiner Geburtsstadt Mainz, wo heute ein Konservatorium seinen Namen trägt.
Klemens Hippel
Erschienen im Klassik-Winter 2024