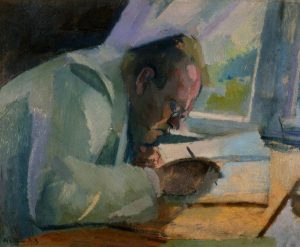Vor 150 Jahren starb William Sterndale Bennett – ein Komponist, den man wiederentdecken sollte
In seiner Jugend eines der größten muskalischen Talente der romantischen Epoche weit über seine Heimat hinaus, fristet William Sterndale Bennetts relativ schmales Oeuvre heute allenfalls ein Schattendasein. Dabei hätten es viele seiner eleganten und fein ausgehörten Klavierwerke, seine Konzerte und Sinfonien verdient, auch in unseren Tagen häufiger auf den Konzertprogrammen vertreten zu sein.
„Ich denke, er ist der vielversprechendste junge Musiker, den ich kenne“, urteilte Felix Mendelssohn Bartholdy 1836 über Bennett. „Und ich bin überzeugt, wenn er nicht ein sehr großer Musiker wird, ist das nicht Gottes Wille, sondern sein eigener.“ Vor allem in Deutschland galt Bennett als eine der größten Hoffnungen der romantischen Schule. Mendelssohn lud den jungen Engländer nach Leipzig ein, nachdem er ihn 1833 mit seinem ersten Klavierkonzert in London gehört hatte, „nicht als mein Schüler, sondern als mein Freund“.
Ab 1836 hielt sich Bennett mehrmals für längere Zeit in Deutschland auf, zunächst mit einem Stipendium der Pianoforte-Manufaktur Broadwood and Sons. Vor allem in Leipzig, wo er vorzugsweise residierte, wurde sein Klavierspiel hochgelobt. Hier kam im Januar 1837 auch seine Ouvertüre „Die Najaden“ zur Aufführung, die seinen Ruf als Komponist weiter festigte. Für Robert Schumann, mit dem Bennett in Leipzig lange Spaziergänge und feuchtfröhliche Kneipenbesuche unternahm, war er „der musikalische Stolz ganz Englands“. „Ja, gäb es nur noch viele Künstler, die in dem Sinne wie W. Bennett wirken – und Niemandem dürfte mehr vor der Zukunft unserer Kunst bange sein.“

Geboren am 13. April 1816 in Sheffield, verlor er schon im Alter von drei Jahren seine Eltern und wuchs beim Großvater väterlicherseits auf. 1824 wurde er Knabensänger im King’s College Chapel Choire, zwei Jahre später begann er sein Studium in den Fächern Geige und Klavier an der Royal Academy of Music in London. Sein Lehrer Cipriani Potter machte ihn nicht nur mit den wichtigsten Werken Bachs, Scarlattis, Clementis und vor allem Mozarts bekannt, sondern sorgte auch dafür, dass Bennett Kompositionsunterricht bei zwei der wichtigsten Lehrer der damaligen Zeit, Charles Lucas und William Crotch, erhielt.
Seine erste Stelle führte ihn 1833 nach Wandsworth, wo er als Organist an der St. Anne‘s Chapel wirkte. Hier entstanden zwei seiner Klavierkonzerte sowie einige Kammermusikwerke, Klavierstücke und Lieder. Seinen Durchbruch als Komponist und Interpret brachte aber erst sein Aufenthalt in Leipzig in den Jahren 1836/37. Im Leipziger Gewandhaus wurde er als Solist in seinem dritten Klavierkonzert bejubelt, für die Schwester des dortigen Konzertmeisters Ferdinand David komponierte er sein bravouröses „Capriccio“ für Klavier und Orchester. Schumann wurde nicht müde, Bennett in seiner „Neuen Zeitschrift für Musik“ zu loben: „Sollte ich noch etwas über den Charakter seiner Compositionen sagen, so wäre es wohl, dass Jedem im Augenblick die sprechende Bruderähnlichkeit mit Mendelssohn auffallen wird. Dieselbe Formenschönheit, poetische Tiefe und Klarheit, ideale Reinheit, derselbe beseligende Eindruck nach außen, und dennoch zu unterscheiden.“
Und seine spätere Frau Clara Wieck notierte 1837 in ihrem Tagebuch: „Schumann hat einen wunderschönen Aufsatz über Bennett geschrieben, und zwar aus Widerspruch gegen uns hat er gesagt, Bennett sey der genialste Künstler.“ Die Freundschaft mit Bennett ging so weit, dass Schumann ihn – übrigens zusammen mit Walther von Goethe – im Mai 1837 mitnahm zu seiner Familie nach Zwickau. Außerdem widmete er Bennett eines seiner wichtigsten Klavierwerke, die Symphonischen Etüden op. 13, die 1837 bei Tobias Haslinger in Wien erschienen. Bennett seinerseits dezidierte Schumann seine Fantaisie pour le pianoforte op. 16. Während dieser Zeit führte Bennett ein Reisetagebuch, das erhalten geblieben ist und in dem sich Informationen aus erster Hand über die Gewandhauskonzerte unter Mendelssohns Leitung, das Publikum der eher privaten Soireen, über gesellschaftliche Ereignisse und die Situation des Musiklebens in Leipzig finden.
Die Aufenthalte dort gehörten zu den produktivsten Jahren im Leben Bennetts. Mehrere Klavierkonzerte, Sinfonien und Ouvertüren ‒ allein sein Schaffen für Orchester in dieser Zeit ist beeindruckend. Hinzu kommen zahlreiche pianistische Charakterstücke, die zu dem Schönsten gehören, was Bennett geschaffen hat. Werke wie die Drei musikalischen Skizzen op. 10, die Vier Stücke op. 28 oder die Drei Romanzen op. 14 zeigen, dass er einer der feinfühligsten und elegantesten Pianisten seiner Zeit gewesen sein muss. Auch als Schöpfer origineller und hochexpressiver Kammermusikwerke tat er sich hervor, etwa mit dem frühen Klaviersextett op. 8 oder der Cellosonate op. 31.
Sein letzter Besuch in Deutschland fand 1842 statt. Bennett besuchte Louis Spohr in Kassel und traf ein letztes Mal mit Felix Mendelssohn Bartholdy zusammen. Zurück in London widmete er sich vor allem dem Unterrichten. Allerdings ließen ihm seine Professuren an der Universität in Cambridge und der Royal Academy of Music in London immer weniger Zeit zum Komponieren. Außerdem wurde er 1842 zu einem der Direktoren der Philharmonic Society in London ernannt, was zusätzliche Verpflichtungen mit sich brachte.
Ob es schwindendes Selbstvertrauen war, mangelndes Publikumsinteresse, negative Kritiken oder die Unfähigkeit, angefangene Werke zu vollenden – jedenfalls kam Bennetts kompositorischer Output in den 1840er und 50er Jahren fast zum Erliegen. Viele Arbeiten vernichtete er. Werke wie die späte g-Moll-Sinfonie op. 43 aus dem Jahre 1864 blieben die Ausnahme. Als Reminiszenz an seine frühen, glücklicheren Jahre mag seine Fantaisie-Ouvertüre „Paradies und Peri“ gelten, über einen Stoff, den Robert Schumann in seinen Leipziger Jahren erfolgreich als Oratorium gestaltet hatte. Bennetts nachlassende Schaffenskraft blieb auch dem hellsichtigen Schumann nicht verborgen: „Das eine fangen wir zu fürchten an, Bennett scheint sich immer fester in eine Manier einzuspinnen, aus der er zuletzt nicht mehr herauskommen wird. Er sagt seit kurzem immer dasselbe, nur in veränderter Form; je vollkommener er die letztere zu beherrschen gelernt hat, je mehr scheint die eigentliche Erfindungskraft in ihm abzunehmen.“
Bennett widmete sich stattdessen verstärkt organisatorischen Tätigkeiten. Neben dem Unterrichten organisierte er ab 1843 eine Reihe mit Kammerkonzerten, bei denen auf dem Kontinent so prominente Künstler wie Joseph Joachim oder die gefeierte Sopranistin Jenny Lind erstmals in London auftraten und die bis 1856 Bestand hatte. 1849 gründete er die Londoner Bach-Gesellschaft. Hier leitete er 1854 die erste Aufführung der „Matthäus-Passion“ in England. Überhaupt verlegte sich Bennett in diesen Jahren stärker aufs Dirigieren. Als Clara Schumann im April 1856 ihr Londoner Debüt gab, stand Bennett am Pult. Doch als man ihm 1853 den Chefposten beim Leipziger Gewandhausorchester anbot, lehnte er ab. Zu eng hatten ihn inzwischen seine zahlreichen offiziellen Funktionen mit dem Londoner Musikleben verknüpft.
Auch wenn er in fortgeschrittenem Alter immer weniger komponierte – sein letztes großes Werk war die geistliche Kantate „The Woman of Samaria“, entstanden in den Jahren 1867/68 – war seine Bedeutung als eine der wichtigsten Persönlichkeiten im englischen Musikleben unbestritten. 1870 verlieh man ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Oxford, ein Jahr später wurde er in den Adelsstand erhoben. Bis zu seinem Tod 1875 setzte er seine Unterrichtstätigkeit fort und trat gelegentlich als Orchesterleiter auf.
William Sterndale Bennett hat die Klaviermusik der Romantik um einen ganz eigenen Ton bereichert. Seine nuancierte Palette an Klangfarben und seine sehr persönliche harmonische Sprache, gepaart mit Eleganz und einer vielleicht typisch britischen distinguierten Zurückhaltung, machen ihn zu einem der interessantesten Vertreter der romantischen Klaviermusik im Umfeld Schumanns und Mendelssohns.
Martin Demmler